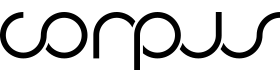Wunderbare Welten oder Die geheimnisvolle Sprache eines fernen Geisterreichs: E. T. A. Hoffmanns „romantische“ Opern
von Frank Piontek, 27.10.2013
Natürlich: jeder kennt „romantische Opern“, zumindest eine: Carl Maria von Webers Freischütz, vielleicht auch die Euryanthe, vielleicht, wenn er sich gut auskennt, Werke von Louis Spohr oder gar E. T. A. Hoffmann. Stellen wir uns aber einmal ganz dumm und fragen wir: „Wat is eigentlich e ‚Romantische Oper‘?“
Wer in die jüngste Forschungsliteratur schaut, könnte durchaus irre werden an dieser simplen Frage, die doch so einfach zu beantworten ist: Eine romantische Oper ist eine romantische Oper ist eine romantische Oper…
Skepsis aber ist spätestens seit jenem Moment angebracht, in dem Carl Dahlhaus in seinem Aufsatz „Romantishe Oper und symphonischer Stil“ die kritischen Sätze erstmals 1984 veröffentlicht hat: „Die romantische Oper – die Oper aus dem Geist der Romantik – war in ihrer gesamten Geschichte, von E.T.A. Hoffmann bis zu Hans Pfitzner, mit Schwierigkeiten belastet, die sich immer wieder als eigentlich unlösbar erwiesen. […] Zweitens war die romantische Oper, entgegen einem eingewurzelten Vorurteil der Musikgeschichtsschreibung, keine Gattung, sondern eine Idee“ (hier zitiert nach Norbert Miller und Carl Dahlhaus: Europäische Romantik und Musik, Bd. 2, Von E.T.A. Hoffmann zu Richard Wagner 1800-1850, Stuttgart 2007, S. 280-294, hier S. 280). Es kommt hinzu, dass, laut Dahlhaus, der Begriff der „Romantik“ von dem des „Romanesken“ unterschieden werden müsste, und schließlich – was jedem einsichtig sein wird, der nur E.T.A. Hoffmanns Beethoven-Rezensionen zur Kenntnis nimmt – „die romantische Musikästhetik primär eine Metaphysik der Instrumentalmusik – oder genauer: der Symphonie“ war (Dahlhaus, S. 281). Lassen wir zunächst einmal den Theoretiker beiseite und den Dichter sprechen – denn so unterschiedlich die Ausprägungen des Romantischen innerhalb der verschiedenen Gattungen: der Symphonie, der Oper und der Kirchenmusik – auch sein mögen, so sehr könnte man sich zunächst auf einen präzisen Zeitpunkt zurückziehen, der am Beginn der Kompositionsgeschichte der sogenannten „Romantischen Oper“ liegt. Nehmen wir also die Werke E.T.A. Hoffmanns zur Hand, um in einem Spezialfall – dem der Hoffmannschen Ästhetik – eine individuelle Ausprägung der „Romantischen Oper“ zu untersuchen – denn die „Romantische Oper“ an sich ist ja, genau betrachtet, keine eindeutig definierbare Gattung, sondern nur, aber immerhin (indem sie eine Idee ist), wie jenes Platonsche Ding an sich in ihren irdischen Hervorbringungen zu entdecken.
E.T.A. Hoffmann, unter den Musikern der bedeutendste Theoretiker dieser Gattung, die keine werden sollte (zumindest keine eindeutig festgefügte), hat sich v.a. in seinem großen Kunstgespräch Der Dichter und der Komponist über die „romantische Oper“ geäußert und sie definiert. Zusammen mit einigen anderen Aussagen, die er in seinen Rezensionen fixiert hat, lässt sich so etwas wie eine konsistente Theorie der Romantischen Oper extrahieren – es ist eine Theorie, weil Hoffmann seinen Dialog in einer Zeit geschrieben hat, da die Aurora zwar schon komponiert war aber noch nicht vollständig dieser Theorie gehorchte, und da die Undine, diese „erste romantische Oper“, wie sie gern genannt wird, noch nicht vorlag. Versuchen wir also, Hoffmanns Theorie ¨C mit Hilfe seiner eigenen Worte und einiger Übersetzungen ¨C in Kürze darzustellen, um sie auf seine praktischen Arbeiten anzuwenden. Denn wie anders kann das Phänomen der „Romantischen Oper“ bei Hoffmann erläutert werden, als dass wir seine Theorie vom Kopf auf die Füße der Praxis stellen? An seinen Werken allein muss es sich beweisen, ob seine Theorie der Wirklichkeit des Kunstwerks standhält.

Also: Die Romantische Oper:
1. In einer authentischen, d.h. romantischen Oper entspringt im Sinne eines musikalischen Dramas die Musik unmittelbar und notwendigerweise aus der Dichtung. Die konsequent vorwärts schreitende, dichterisch schnörkellose Handlung schwebt in mächtiger Musik vorwärts und ergreift zutiefst, weil das Wunderbare als poetisch wahr erscheint.
2. In der romantischen Oper wird die Einwirkung höherer Naturen gezeigt, um dem Betrachter und Zuhörer ein romantisches Sein zu erschließen. Dessen machtvolle Musik ist die geheimnisvolle Sprache einer fernen fantastisch-metaphysischen Welt (nicht die Musik äußerlicher Gespenster und Fabelwesen), deren dynamische Betonungen in unserm Inneren widerklingen. Schon der Text der Oper ist Musik, da sie jener höheren Welt, doch nicht der Effekthascherei geläufiger Gurgeln entspringt und er untrennbar mit ihr verbunden ist.
3. In der romantischen Oper mischt sich das Komische mit dem Tragischen derart, dass beides in eins verschmilzt.
4. Der wichtigste Exponent der vorromantischen Oper ist Gluck; ein idealer Stofflieferant wäre Carlo Gozzi.
Es ist ein liebgewordener Topos geworden: dass Hoffmanns Musik nicht jener fantastischen Welt entspricht, die er in seinen Erzählungen so magisch ausgebreitet hat. Zumindest in älteren Monographien kann so etwas gelesen werden; auch muss sich der Autor dieser Untersuchung selbst beim abgewetzten Kragen packen lassen. Er selbst war, als er zum ersten Mal (anlässlich einer Aufführung der Oper im E.T.A. Hoffmann-Theater Bamberg im Jahre 1995) die Undine hörte, nicht sonderlich begeistert von dieser musikalischen Welt, die ihm aufs erste und noch aufs zweite Hören nicht „romantisch“ oder „fantastisch“ genug schien, um mit den so ganz anders gearteten Werken des Dichters Hoffmann auch nur annähernd konkurrieren zu können. Lange Zeit schien ihm das allerdings ingeniöse, allerdings eher den Mustern der Wiener Klassik gehorchende Harfenquintett als das Höchste der Hoffmannschen Musikmuse. Nur hatte er damals Einiges übersehen: erstens die Tatsache, dass ein Musiker des frühen 19. Jahrhunderts noch nicht wie Hector Berlioz komponieren kann und die Ausprägung des hoffmanesk „Romantischen“ im Medium der Musik eine gänzlich andere Gestalt annehmen muss als im Medium der Literatur, und zweitens, dass die genaue Analyse von Text und Musik der beiden Opern, die als „romantisch“ gelten, zudem der Vergleich mit gleichzeitig komponierten Opern, sofort das Andere der romantischen Ästhetik des Komponisten E. T. A. Hoffmann zum klingenden Vorschein bringt. Letztere Arbeit wurde vor Allem, gestützt auf die Arbeiten Hermann Dechants und Gerhard Allroggens, in bewunderungswürdiger Tiefe und Breite von Norbert Miller geleistet. Seine monumentale zweibändige Musikgeschichte der europäischen Romantik, die er zusammen mit Carl Dahlhaus veröffentlichte, hat endgültig aufgeräumt mit dem minderen Rang des Opernkomponisten E. T. A. Hoffmann. Im Folgenden werde ich mich also notwendigerweise und mit Freude auf die Forschungen Norbert Millers beziehen, wenn es darum geht, Hoffmanns Theorie an seinen Werken zu erweisen – oder zu widerlegen.
Zunächst aber noch ein bisschen Theorie – denn kein Wort versteht sich von sich selbst. Schauen wir uns erst einmal die Theorie an und versuchen, die Worte zu verstehen.
Klar ist, dass Text und Musik eines Dramas gleichsam zusammenhalten müssen, dass beides allem Zufällig-Ornamentalen mangelt und die Musik dem Text entspringt. Hoffmann selbst hat sehr schnell geschrieben; ein Operntext musste – so müssen wir die ungeheure Geschwindigkeit interpretieren, mit der er die beiden Göttinnen Aurora und Undine komponierte – auf ihn derart inspirierend wirken, dass beim Lesen des Textes die Musik aus ihm heraus sprang wie die Athene aus dem Haupt des Zeus: schlagartig. Theoretisch ist es nämlich nur schwer zu belegen, inwiefern „die Musik unmittelbar aus der Dichtung als notwendiges Erzeugnis derselben entspringt“ und genau dies das Signum einer „wahren“, d.h. „romantischen“ Oper ist. Je länger man sich nämlich mit älteren Werken befasst: angefangen mit Claudio Monteverdis favola in musica namens Orfeo. Desto nachdenklicher wird man, was das Alleinstellungsmerkmal der „wahren, romanischen“ Oper betrifft. Niemand, der einen Sinn für musikalisch-dramatische Unterscheidungen hat, wird bestreiten, dass es sich schon bei der favola, die bezeichnenderweise noch nicht „Oper“ genannt wurde, um ein veritables Musikdrama handelt, in dem sozusagen jede Note an der richtigen Stelle steht. Dass die „Poesie der Musik gehorsame Tochter“ ist, wie das bekannte Bonmot Wolfgang Amadé Mozarts lautet, meint eben diesen innigen Zusammenhang zwischen Text und Musik, in dem das Verhältnis nicht zu Ungunsten des Librettos geregelt wird, aber in einem freundlichen familiären Verhältnis steht, das jeder Opernkomponist von Rang auf seine Weise knüpfte. Es ist kein Zufall, dass der Librettist der „Dramatick Opera“ King Arthur, John Dryden – in seinem Vorwort zur Dichtung, das er „für Henry Purcell“ schrieb – schon 1691 ganz selbstverständlich bemerkte, dass „Musik und Dichtung immer als Schwestern angesehen wurden, die einander hilfreich die Hände geben. […] Beide können auch für sich bestehen, aber die eindrücklichste Wirkung werden sie hervorbringen, wenn sie vereinigt sind, weil dann keine ihrer Vollkommenheiten fehlt“ (King Arthur, Programmheft der Salzburger Festspiele 2004, S. 39). Wer sich weiter in der Barockoper umtut, die ja bei uninformierten Zeitgenossen immer noch als Gesangsoper definiert wird, als sei der Text nur dazu da gewesen, um von der Musik ummäntelt zu werden, könnte bei der Analyse von Text und Musik darauf kommen, dass – allen Konventionen zum Trotz – die Musik meist sehr genau den Affekt schildert, den der Text vorgibt. Dass das Drama des Barock aus seichten, immer schon bekannten Handlungen besteht und das Publikum nur in die Oper ging, um geläufigen Kastratengurgeln zu lauschen und zwischendurch Eis zu essen, zu plaudern und bei Gelegenheit die Vorhänge der Loge zu schließen – dann nämlich, wie Herbert Rosendorfer einmal bemerkte, wenn das Geschehen in der Loge dramatischer wurde als das auf der Bühne: diese Meinungen haben sich als schwer revisionsbedürftig erwiesen. Nicht erst in Mozarts reifen Opern gibt es jene Verschwisterung von Text und Musik – schon bei Händel, dann beim jungen Mozart, erscheinen Musikdramen auf den Bühnen, die die Banalitäten einer primitiven, durch die Musik eher verdeckten als beförderten Handlung abgestreift haben. Im Sinne Hoffmanns haben wir es also bei vielen Bühnenstücken des 17. und 18. Jahrhunderts mit „wahren Opern“ zu tun, die sinnlos (oder anderssinnig) würden, würden wir ihnen einen anderen Text oder eine andere Musik unterschieben.
Hoffmann ist übrigens nicht der Meinung, dass ein Künstler zugleich eine Oper dichten und komponieren müsse, wie dies – im Geburtsjahr des Dichterkomponisten Richard Wagner, der sozusagen die Autorenoper geschaffen hat – der musikbegeisterte Dichter Jean Paul in der Vorrede zu den Fantasiestücken in Callots Manier visioniert hatte. Lediglich ein Bühnenwerk hat Hoffmann komponiert und getextet: das Singspiel Die Maske.
Wie aber soll die Musik der „romantischen Oper“ beschaffen sein? Sie soll, der Handlung analog, „in mächtigen Tönen und Klängen schwebend, uns gewaltiger ergreifen und hinreißen“. „Mächtige Töne und Klänge“ – es gab sie schon vor dem Jahre 1811, bevor Hoffmann, auffallend dezent und subtil, den Aufgang der Aurora in Töne setzte. „Gewaltiges Ergreifen und Hinreißen“ durch eine musikalische Handlung oder eine handlungsmäßig optimale Musik: sie musste von den „Romantikern“ nicht erfunden werden. Schon die „erhabenen“ Szenen, die in Monteverdis Unterwelt und in Mozarts packenden Dramen, auf Friedhöfen, in Kammerkätzchenkammern und in neapolitanischen Salons spielten, gibt es jenes ergreifende wie hinreißende, ins Innerste wirkende Ineinander von Bild und Klang, Handlung und Ton – unterstützt durch spezifische Instrumentationen und individuelle Harmonien. Jede Mozartoper hat bekanntlich einen anderen Klang, ein anderes Valeur, andere Lichter und Schattierungen. Das chiaroscuro – die Verteilung von Licht und Schatten – ist keine Erfindung jener Komponisten, die ihre Wolfsschluchten zwischen Tanzplatz und Försterhaus und ihre Wasserunterwelten zwischen Fischerhütte und Stadtplatz ansiedelten. Schon Mozarts wundersam sehnsüchtiges, auf das Meer hinaus gesungene Terzett Soave si il vento erfüllt alle Bedingungen der Hoffmannschen Definition romantischer Musikrezeption.
Kommt hinzu ein grundsätzliches Problem, das hier nur angerissen werden kann: dass die an der Betrachtung der Beethovenschen Symphonie gewonnene Ansicht der romantischen Musik, dieser „geheimnisvollen Sprache eines fernen Geisterreichs“ (Hoffmann hat diese These nicht erfunden, schon bei Wackenroder und Heinse wird über eine romantische Musik nachgedacht) zunächst auf die reine Instrumentalmusik gemünzt wurde. Carl Dahlhaus hat dieses Problem konzis umrissen: „Hoffmanns Versuch, eine Ästhetik der romantischen Oper zu begründen, verstrickte sich also dadurch in Schwierigkeiten, dass erstens die Oper als Drama irdischer Affekte in Gefahr geriet, die überirdische Sprache der Musik ihrem eigentlichen Wesen zu entfremden, zweitens die Idee des Romantischen eine manifestere Bühnenexistenz kaum anders als in einem Genre zu gewinnen vermochte, das unter Trivialitätsverdacht stand, und drittens die differenzierte thematisch-motivische Struktur, in der Hoffmann 1810 das technische Korrelat zum romantischen Wesen der Beethovenschen Symphonie erkannte, im frühen 19. Jahrhundert, vor Wagners Musikdramen seit Rheingold, als unaufhebbar opernfremd erscheinen musste“ (Dahlhaus, S. 281f.). In seinem Künstlerdialog hat Hoffmann versucht, diesen Gegensatz durch den Hinweis auf den Charakter einer wahren romantischen Operndichtung abzumildern: eine Operndichtung, in der das Erfundene, das nicht mehr romanesk ist, „poetisch wahr“ ist.
Dass das Wunderbare als poetisch wahr erscheint: es mag allerdings in diesem Gemenge von Poesie und Musik als spezifisch romantisch gelten – denn glaubte wirklich ein Zuschauer des Jahres 1600 an Monteverdis und Alessandro Striggios d. J. Götter und Geister? Hielt man die fantastischen Gestalten, die Höllenhunde und unsterblichen Nymphen der Barockoper für „poetisch wahr“? Man weiß es nicht (vielleicht weiß man es doch). Der Begriff erscheint bei näherer Betrachtung denn doch als sehr ungenau, also könnte man fragen, wie sich die „poetische Wahrheit“ überhaupt genau definieren lässt. Vermutlich müssen wir uns auf den Standpunkt des wunderbaren Autors des sage und schreibe wunderbaren Romans namens Lord of the rings stellen: es sei ihm darum gegangen, eine fantastische Welt, eine „Sekundärwelt“, derart genau zu konstruieren, dass sie ihre eigene Wirklichkeit und damit ihre Wahrheit besäße. Fantasy muss „als wahr dargestellt werden“, auf dass sie wahr erscheint – so sein Credo (nach Lin Carter: Tolkiens Universum München 2002, S. 135). In diesem Sinne mag auch dem Zuschauer einer „romantischen Oper“ ein „romantisches Sein“ erschlossen werden, ohne dass der Abstand zu herkömmlichen und gegenwärtigen Fantasy-Erscheinungen deutlich würde. Wer genau hinhört, kann auch in der Musik Händels oder Howard Shores, die die Regungen einer metyphysischen Welt zu beschreiben versucht, sein Inneres angesprochen fühlen, ohne dabei gleich an Geister, Elfen und Orks zu denken, oder umgekehrt: es könnte sein, dass die Musik, mit der diese metaphysischen Gestalten ausgestattet werden, über eine bloße tonmalerische, das Feuer, die Luft oder den Schlamm charakterisierende Figurenbeschreibung hinausgeht.
Bleibt die Beobachtung, dass in einer „romantischen Oper“ die Komödie derart mit der Tragödie verbandelt ist, dass man unversehens an die besten Werke W. A. Mozarts oder – auf dem Gebiet des Schauspiels – an Komödien wie Lessings Minna von Barnhelm denkt. Dass Don Giovanni, dieses Dramma giocoso, in E. T. A. Hoffmanns Wertesystem eine besonders hohe Rolle einnahm, ist bekannt, aber niemand wird auf die Idee kommen, die Oper über den „dissoluto punito“ oder eine Semiseria des 18. oder gar schon des 17. Jahrhunderts als „romantisch“ zu bezeichnen – nicht einmal, im Blick auf die Friedhofsszene und die barocken pezzi di ombra (die beliebten Schatten-Szenen), als vor- oder gruselromantisch. Auch hier werden, wenn man Hoffmanns Terminologie auf die Epochengeschichte anwendet, die Begriffe seltsam unscharf.
Was schließlich die Berufung auf Carlo Gozzi betrifft, so könnte man den Spielverderber markieren und bemerken, dass Richard Wagners Die Feen zwar nach Gozzis Donna serpente gearbeitet wurde, der Jungmusikdramatiker aber den Stoff derart gravierend veränderte, dass zwar einerseits von einer „romantischen Oper“ in irgendeinem Sinne „nach Gozzi“ gesprochen werden kann. Andererseits aber beginnt sich dieses vielbeschworene Romantische in jenem Moment aufzulösen, in dem wir bemerken, dass Wagners Feenwelt von der (von Wagner kritisch gesehenen) Gegenwart der Restaurationsepoche derart infiziert wurde, dass sich das sogenannte Wunderbare schnell in die Depression, den temporären Wahnsinn und die Katastrophe, schließlich in ein lieto fine auflöst, das – der wahrlich „schönen“ Finalmusik zum Trotz – den Konflikt zwischen Menschen- und Geisterwelt nur noch mit Hilfe der Konvention und der Utopie einer Versöhnung der verschiedenen Sphären gewaltsam zu kitten weiß (diese Lesart wurde nachdrücklich von Michael von Soden favorisiert, in: Richard Wagner: Die Feen, Frankfurt am Main 1983, S. 284). Gleiches wäre von Tannhäuser, von Lohengrin und dem Ring zu sagen: das Märchen, die Sage, der Mythos und ihre fantastischen Gestalten sind die pure Camouflage einer schrecklichen Gegenwart, die auf den Opernbühnen des 19. Jahrhunderts anders darzustellen und zu kritisieren kaum möglich war. In diesem Sinne wurde die Romantik tatsächlich zur Gruselromantik: weil das Wunderbare sich längst aus der Gegenwart, aber auch von der Bühne verflüchtigt hat: so wie Lohengrin wieder fortzieht, und so wie Venus und ihre Geister in den Tiefen des Berges wieder verschwinden. Seine Figuren finden am Ende nicht mehr zueinander, erleiden unversöhnbare Schicksale. „Nun ist’s mit unsrer Freude aus“, sagt Undine zum Ritter, nachdem er sie verflucht hat. Dies entspricht jenem „Weh, nun ist all unser Glück dahin“ des tieftraurigen Lohengrin, nachdem Elsa das Frageverbot durchstoßen hat. Natürlich kann man dies als „romantisch“ bezeichnen, da die romantische Welt aus Sehnsucht und Verzicht besteht – aber Wagner hat die Romantik derart auf die Spitze getrieben, dass sie als zerstörte zurückbleibt. Dagegen spricht nicht einmal der Dur-Akkord, in den der „reine Liebestod“ – dies das Schlusswort aus Hoffmanns Undine – nach dem exzessiven, denkbar unromantischen Schlussakt mündet.
Und doch: Hoffmann hat mit der Undine die erste einigermaßen konsistente deutsche „romantische Oper“ geschrieben (ihm vorangegangen sind die Italiener und Franzosen: Cherubini, Méhul, Le Seur: La caverne, 1793). Wer sich nur der Theorie versicherte, würde in die Irre geleitet werden – denn Hoffmanns Forderungen an die Neue Oper muten so manieristisch an wie manche seiner Erzählungen, sind also mithin nicht so ernst zu nehmen, wie es die Interpretationsversuche der Musikwissenschaftler suggerieren. Hoffmanns Musik und Musikdramaturgie allein ist es, die ihn als Komponisten eines „romantischen“ (oder teilromantischen) Bühnenwerks auszeichnet. Man kennt den Begriff der „romantischen Paradoxie“; wer sich seine beiden „romantischen Opern“ genau anhört, kann den produktiven Kontrast ermitteln, der zwischen Hoffmanns schwammiger Theorie und seinen konkreten Werken besteht. Paradox ist dies, weil man eben jene Theorie – zumindest teilweise – auf die Musik anwenden kann.
Allein die Aurora hat von Hoffmann die offizielle Gattungsbezeichnung einer romantischen Oper verliehen bekommen. Undine ist dagegen „nur“ eine „Zauber-Oper“, obwohl sie ihrem Gehalt nach wesentlich „romantischer“ erscheint als das vorangegangene, in den Jahren 1810 und 1811 komponierte Stück. Was also ist „romantisch“ an der Aurora?
Klingt die Partitur aufs erste oberflächliche Hören so, als hätte ein Mozart- und Gluckjünger sich nur in die Spuren der verehrten Meister begeben, so wird man beim näheren Analysieren abweichende Töne wahrnehmen. Romantisch erscheint schon die Idee, die griechische Titelgöttin „als Naturphänomen erscheinen zu lassen“ (Miller, S. 227). Gleichermaßen romantisierend wirkt die subtile Integration der Musik im Rahmen der Dialoge: was noch nichts über den Charakter der Musik an sich aussagt, aber über die genaue Verbindung von Text und Musik, die im Singspiel älterer Facon – denn Aurora ist, ebenso wenig wie Undine, eine durchkomponierte Oper – anders getrennt waren. Romantisch im Klang ist ziemlich deutlich das Vorspiel zum 2. Aufzug und dessen erste Szene, worauf Norbert Miller in einer ausführlichen Analyse aufmerksam gemacht hat (S. 231-237). Die 38 Takte des Vorspiels zeichnen die Nacht, ein schmales Ufer, sehr viel Himmel und sehr viel Wasser, und die Memnonssäule, das Gedenkmal für Auroras einstigen Geliebten. „Das Nachtstück des Orchesters, alle Ahnungen des Morgens in sich tragend, verwandelt bei offenem Vorhang das Bühnenbild mit der Denksäule des Tithonus vor der Unermeßlichkeit von Meer und Himmel in eine geheimnisvolle mythische Seelenlandschaft“ (Miller, S. 231). So hat die Romantik zu klingen. Eine tonmalerische Musik des Meeres, der Nacht und des anbrechenden Morgens.
Bald hebt Aurora den Schleier der Nacht… In die an Gluck erinnernden Klänge des Rezitativs und des tändelnd altertümelnden Arioso des Hirten Cephalus mischt sich die Erhabenheit einer neuen Welt, wie sie durch das griechische Sujet vorgegeben wurde. Von hier aus definierte Hoffmann eine Romantik, die in den Werken des verehrten Opernreformators ihren Anfang genommen hatte. Wenn die Sonne aufgeht, hören wir also keinen strahlenden C-Dur-Akkord, sondern eine Musik der Trauer – denn die Göttin trauert immer noch um das, was sie verlor.
Es ist zuerst der Klang, der das Romantische einzelner Szenen dieser Oper verbürgt, die sich in den Zwischenabständen vor allem auf die gelehrige, durchaus gutgemachte Nachfahrenschaft eines Mozartliebhabers und Gluckverehrers berufen kann. Wenn Cephalus fast so im Liebesreich der Aurora festgehalten wird wie Tannhäuser von Frau Venus, dann ist der mythologische Hintergrund im antiken Griechenland zu suchen – aber die Klangwelt sagt uns, dass wir im frühen 19. Jahrhundert angelangt sind, im Reich jenes Wunderbaren, das der Musiker im Künstlerdialog so wortreich beschworen hat.
Schließlich das Finale: auch hier begegnen Momente einer anderen Welt, die seltsam quer stehen zu den mozartnahen Kantilenen und Duetten, mit denen der Musikdramatiker sein Werk der musikalischen Vergangenheit tendenziell ausgeliefert hat – doch auch hier bestimmt der Bruch, nicht die ästhetische Konsequenz die Frage, ob Aurora ihren Untertitel zu Recht trägt. Das Finale enthält, einer Insel gleich, einen Ruhepunkt, der zwanglos als „romantisch“ bezeichnet werden kann, indem er das Titelthema der Oper – den Sonnenaufgang – wie er schon im zunächst dunklen, dann strahlenderen Beginn des zweiten Akts poetische Wirklichkeit wurde -, zitiert und im pastosen Klangbild auskomponiert. „Das Naturwunder des rosenfarbenen Augenblicks“ (Miller, S. 242), mit dem die Göttin entschwindet, aber bleibt ein zauberhaftes Separatum; der Rest ist, samt „allgemeinem Chor“ und Solisten, ein konventioneller Jubel, der an ein Finale wie das der Zauberflöte erinnert.
Auf formaler Ebene aber scheint Hoffmann die Verbindung von Text und Musik vorangetrieben zu haben. Hermann Dechant, der Kenner der Aurora, meinte, dass der Librettist Franz von Holbein und sein Komponist die „radikal moderne Lösung“ gefunden hätten, „den Verlauf der Handlung in die Musiknummern zu legen und den Dialog nur noch als Konversationsträger einzusetzen“, womit die „Verhältnisse gegenüber der alten Oper ins Gegenteil verkehrt“ wurden (Booklet der Aufnahme der Aurora, Bamberg 1990, S. 6) – womit, so darf man schließen, die Musik zwar nicht unmittelbar und notwendigerweise aus der Dichtung entspringt (denn dies kann sie ja auch in statischen, beschreibenden Arien), aber eine neue Façon gewonnen hat. Die Frage bleibt nur, ob dies nicht schon die Errungenschaft da Pontes und Mozarts war.
Undine (ausführliche Analyse bei Norbert Miller, in: Dahlhaus/Miller, S. 261-279) ist ungleich stärker in jenem romantischen Gebiet angesiedelt, den der Dichter Hoffmann zu umreißen versuchte. Es sind zum einen die dramaturgischen, zum anderen die musikalischen, in ihrer Koppelung die musikdramatischen Elemente, die das Zauber-Singspiel romantisieren: angefangen bei der Wasserfrau. Diese Figur, das zwischen Natur und Kultur changierende Wellenwesen Ondine/Undine, stammt bekanntlich aus der mittelalterlichen Literatur und deren Konzept der stets scheiternden „Martenehe“ zwischen einem Sterblichen und einem weiblichen Fabelwesen – aber Friedrich de la Motte Fouqué hat der Figur in seiner Novelle und seinem Opernlibretto ein gleichsam humanes, da leidendes Gesicht verliehen. Ihr menschlicher Gegenpart, der Ritter Huldbrand, gehört jenem Volk der liebenden, sich in unglückliche Liebesgeschichten verstrickenden Ritter an, die die literarische Romantik – und die Trivialliteratur des „Romanesken“ – so liebte. Entscheidend aber ist, dass Hoffmann dieser aus der Literatur und einem unmittelbaren literarischen Vorwurf gewonnenen Geschichte mit einer Klangkonzeption beikam, die sie, cum grano salis, zu jener romantischen Oper macht, über die der Rezensent Carl Maria von Weber (in Kunstansichten, Leipzig 1975, S. 140; auch in Fouqué: Undine, Frankfurt am Main/Leipzig 1992, S. 115-122) so begeistert schrieb.
Handelt es sich bei Undine auch um eine Nummernoper mit eingestreuten Dialogen – und ausgeweiteten Finali -, so verstanden es Fouqué und Hoffmann auf spannungsvolle Weise, immer wieder die Musik in die gesprochene Sprache eindringen zu lassen. In der Romanze des Fischers, der die Geschichte des gefundenen Kindes Undine erzählt, nachdem ihnen die richtige Tochter abhanden gekommen war („Wir weinten still im kleinen Zimmer…“), erlaubt es diese Technik, den Einbruch des Wunderbaren fugenlos zu ermöglichen. Urplötzlich nämlich ertönt der Chor der Wassergeister „hinter der Bühne“ und begleitet auf durchaus unheimliche Weise die Erzählung. Das Rauschen der „Wogenlieder“ und „Wellenklänge, wie seltsame Wogenhänge“, gewinnt unversehens eine Präsenz, die aus jenem „Geisterreich“ stammt, von dem der Musiker Ludwig sprach. Mag sein, dass die Präsenz in diesen Augenblicken eher dem „Romanesken“ als dem rein „Romantischen“, also Metaphysischen angehört. Der Effekt ist derart impressiv, dass wir zumindest an die Theaterwunder zu glauben beginnen, „die als notwendige Folgen der Einwirkung höherer Naturen auf unser Sein sichtbarlich geschehen“.
Hoffmann gelingt diese Vergegenwärtigung des Übersinnlichen und des Spukhaften der Elementargeister durch eine profunde wie kontrollierte Klangmalerei, die sich aufs Handwerk verlassen kann. Der Wassermann, der eigentliche Gegner des Ritters, der dessen Tochter ihm durch Liebe entwand, wurde von Hoffmann mit einem dunklen Posaunenschleier ausgestattet, der ihn als numinose Gestalt kenntlich macht. Auch dieser Effekt ist nicht eigentlich neu, es waren immer die Posaunen, mit denen die Götter – von Monteverdis Plutone über die göttliche Stimme im Idomeneo bis zu Wagners Wotan – auftraten, doch sorgt die mythisch-musikalische Klangfigur dafür, der Gestalt eine Kraft zu verleihen, die sie in die Nähe jenes „Wunderbaren“ rückt, das das geheime Fernziel aller Romantiker war. Im zweiten Akt wird Kühleborn, der Wassermann, eine Arie singen, die vom Chor der Wassergeister begleitet wird: „Ihr Freund aus Seen und Quellen…“. Die Wassergeister beschwören die Rache, die der zornige Vater am menschlichen Verräter üben will. Die Musik strömt in dunklem Wohllaut dahin, weil der Musiker die Wasserwelt auf eine Weise ins Klangbild gesetzt hat, wie sie bislang unerhört war (sieht man einmal davon ab, dass das Wellenmotiv ein Topos ist, der, beispielsweise, in Mozarts Soave si il vento nicht das erste Mal buchstäblich auftauchte und Hoffmann auch hier dem Ritter Gluck einiges zu verdanken hatte).
Mozart und Gluck – sie spuken tatsächlich noch in der Partitur herum. Bei näherer Betrachtung müsste man also die Definition der Romantischen Oper E. T. A. Hoffmanns – denn es kann nur um einen Einzel-, nicht um einen Regelfall gehen – mit jener musikalischen Tradition verkoppeln, auf die der Komponist, ohne Scheu, selber hingewiesen hat, ja: Hoffmann „beharrt in der großartig freien Verknüpfung der Elemente des Musikdramas und des Singspiels auf der prinzipiellen Anerkennung der von ihm übernommenen Muster!“ (Miller, S. 275) Norbert Miller kommt sogar zum paradox erscheinenden Schluss: „Die romantische Oper kann sich nur durchsetzen, wenn sie ihre Herkunft noch in der Überwindung zu erkennen gibt.“ Singspielhaft sind manch Gesänge, moderner muten die Instrumentaleffekte an – aus diesen Gegensätzen zieht Hoffmanns romantische Oper – in der Praxis, nicht in der Theorie! – ihre Eigenheit. So wie Schinkels ingeniöses Bühnenbild zur Schlussszene einen Wasserpalast zeigt, der streng symmetrisch und eben nicht natürlich und „romantisch“ anmutet -, so trägt Undine die Züge zweier Zeitalter. Unkonventionell ist die Idee, den Ritter als passiven Helden zu zeichnen, daher er auch keine eigene Arie besitzt – seltsam bekannt mutet manch Ensemble an, das eher den Standard von 1790 als von 1813 verbürgt. Dafür ist Kühleborn ein wirklich geisterhafter Widersacher – Louis Spohr hatte dagegen in seinem Faust, just im Jahre 1813, mit dem Mephisto einen konventionellen, aller dämonischen Tiefe ermangelnden Bösewicht komponiert. Hoffmanns Instrumentation und Harmonik aber ist modern und differenziert, im Dunkelnächtigen findet sie ihr Glück: wenn Kühleborn zu Beginn des 2. Akts aus dem Brunnen, der Passage zur unheimlich-heimlichen Anders- und Unterwelt heraufsteigt, hören wir Fagotte, Violoncelli und Kontrabässe und aufsteigende Nonen.
Auch formal erfüllt Hoffmann die Bedingungen des Romantischen, wie er sie in seinem Gespräch angedeutet hatte. Die Szenenfolge und die ausgeweiteten Szenenkomplexe, verbunden mit Personalmotiven für die mythischen Figuren, sorgen zusammen mit den „volkstümlichen“ Balladen- und Liedformen, auch Undines tief empfundenem, schlichten Lamento, für eine Opernform, die mit der traditionellen Nummernoper für „geläufige Gurgeln“ nicht mehr allzu viel zu tun hat (wobei auch hier Mozart vorangegangen ist). Wo sich die quasi menschlichen Ausdrucksformen – repräsentiert in der Ballade – und die gleichsam „grauenvollen“ Äußerungen der fantastischen Geisterwelt abwechseln oder gar konfrontiert werden, wird das „Romantische“ im Wiederspiel von „Realismus“ und „Wunderwelt“ tatsächlich wirklich. Der Preis für diese Darstellung einer romantisch sein wollenden Welt war vermutlich die Integration der älteren musikalischen Formen in ein Gewebe, das nicht zu überhörende Widersprüche aufweist (wer Koloraturen für „romantisch“ hält, wird auch in diesen Einsprengseln die Oper für originell halten. In der Aurora singt die Göttin im dritten Akt eine Arie, die derart reich mit diesen Zierformen ausgestaltet ist, dass die Erinnerung an die Mozart-Oper übermächtig wird). Vielleicht war dem Komponisten auch aufgegangen, dass das ersehnte „Romantische“ im Medium einer konkrete Handlungen abbildenden Oper nicht völlig zu gewinnen war; vielleicht verzichtete er aus diesem Grund auf den kühnen Titel einer „romantischen Oper“ – für ein Werk, das insgesamt „romantischere“ Elemente aufweist als die Vorgängerin Aurora. Dass es Hoffmann, zusammen mit seinem kongenialen Librettisten, gelang, wenigstens in einigen Nummern den Traum von etwas gänzlich Anderem, einen Klang, der aus der Anderswelt herüberzutönen scheint, zu realisieren: schon dies war eine historische Leistung, die nicht unterschätzt werden sollte (Weber sah dies, bei aller Bewunderung für das Werk, eher kritisch; er tadelte „die Vorliebe für Violoncelle und Bratschen, für verminderte Septimen-Accorde, und oft zu schell abgebrochene Schlüsse“: Kunstansichten, S. 139).
Aurora konnte aufgrund ihrer Nichtaufführungsgeschichte keine Wirkung erzielen, Undine wurde in Berlin bejubelt, aber bald darauf – nach dem Brand des Berliner Schauspielhauses und der vorläufig letzten Berliner Aufführung – vergessen. Weber kannte das Werk, lobte es und komponierte einige andere „romantische Opern“, die sich von Hoffmanns Meisterstück weit entfernen, ohne den Vorgänger vergessen zu machen. Ob Wagner die Oper kannte, ist unwahrscheinlich – aber von der Schlußszene der Undine führt ein Weg noch zu Wagners Erlösungsfinali. Nachdem Berthalda – Repräsentantin des eher „bösen“ Menschlichen – befohlen hat, den verschlossenen Brunnen, den Zugang zur Wasserwelt zu öffnen und die Menschenwelt mit der Geisterwelt zu verbinden, erscheint plötzlich Undine, die davor gewarnt hatte, den Zugang jemals wieder zu entsiegeln. Die Musik verbürgt eine tiefe Traurigkeit dem Fatum gegenüber, das den einstigen Geliebten töten wird: „Hab‘ gute Nacht.“ Huldbrand nämlich wird wiederum verzaubert: seiner Sinne nicht mehr mächtig und doch ganz bei sich und der wirklichen Geliebten, die er um Berthaldas willen verließ. „O wie lieblich sie lacht. Nicht einen Kuss?“ Und Undine antwortet: „Ja, Lieber, weil ich muss, / doch küss ich dich zum Sterben.“ Es passiert, und Heilmann, der Vertreter des Christentums, hat nur noch die Verkündigung zu sagen: „O stille, des Himmels milder Wille / hat ihn zum reinen Liebestod erkoren.“ Nun geht eine schlichtweg zauberhafte Verwandlung in Form einer zweifellos romantischen Phantasmagorie vor sich: „Knappen legen den Ritter auf die Bahre, die tragen ihn hinter das Monument. Es steigt ein graues Nebelgewölk aus dem See“. Der Schlusschor beschwört schließlich in süßer Lyrik ein letztes Mal die Hochzeit von Liebe und Sehnsucht: „Reines Minnen, holdes Sehnen, / wohnt im süßen Widerschein, / ernstes Singen, süßes Wähnen / schaut voll Andacht da hinein, / möchte bei Undinen sein! / Gute Nacht all Erdensorg und Pracht.“
Hat Hoffmann mit dem „allgemeinen Chor“ die Menschen- oder die Wasserwesen gemeint? Die Frage ist nicht wichtig, denn die Musik allein beschwört mit ihren beiden Chören von Mann und Frau den Blick in eine ferne Welt, die im Untertitel der Oper anklingt: eine Zauber-Welt. Allein auch sie verschwindet in jenem „Nebelgewölk“, so dass, wie Hoffmann in einer Bemerkung zur Inszenierung schrieb, am Ende „beinahe alles wieder verschwunden ist“ – so verschwunden wie die zauberhafte Imagination einer „wahren romantischen Oper“ und eines „fernen Geisterreichs, deren wunderbare Akzente in unserm Innern widerklingen“ – eine Imagination, die, nicht mehr, aber auch nicht weniger, bei E.T.A. Hoffmann wenigstens in ein paar glücklichen Momenten Wirklichkeit wurde.